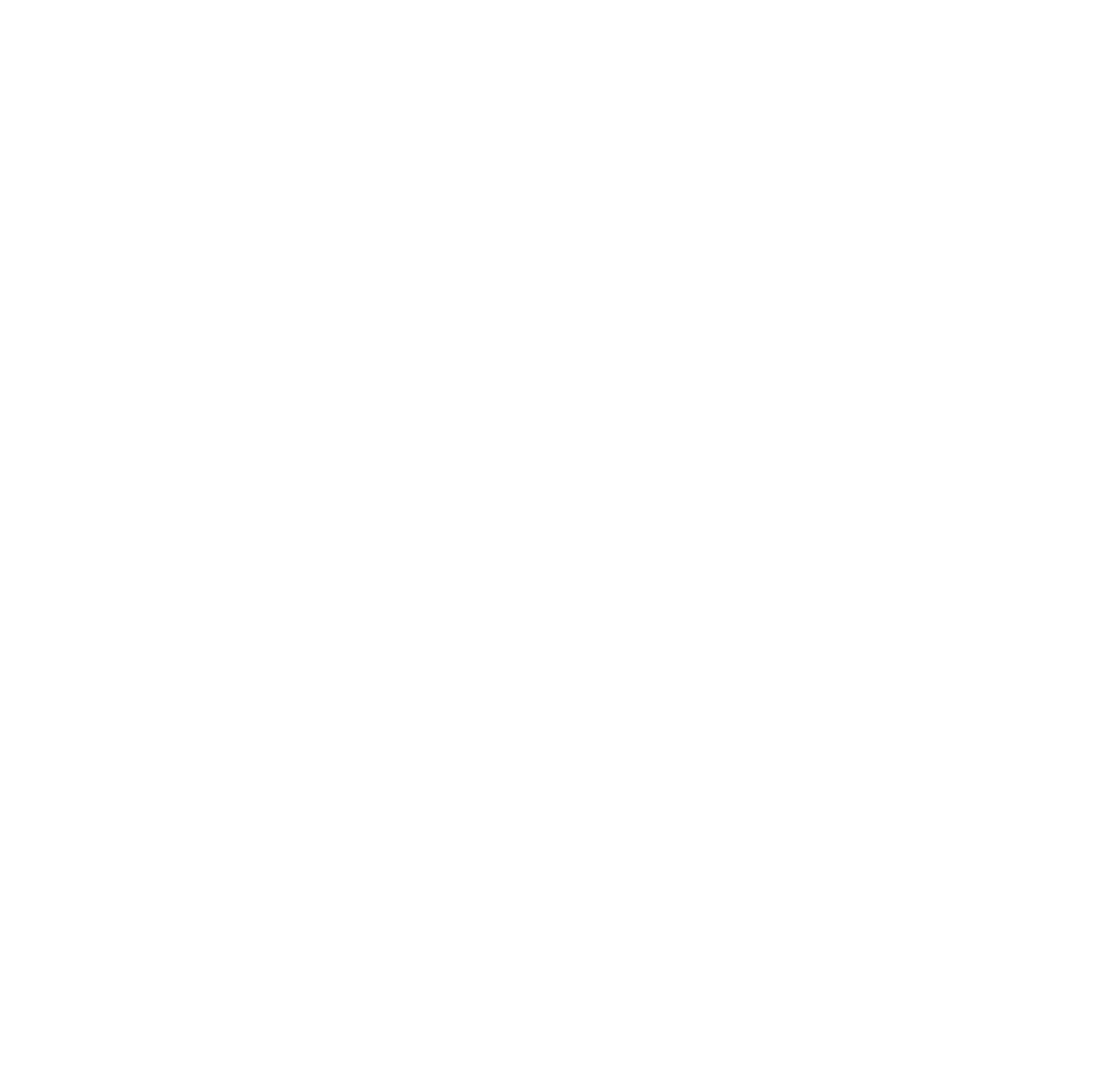Es gibt ein Gleichnis von Nietzsche, in dem ein Mann mit einer Schlange ringt, die ihm in den Mund gekrochen ist und sich dort festgebissen hat. Es ist das Gleichnis des Menschen, wie er mit der Beschaffenheit seines Wesens ringt und droht, daran zu ersticken.
Die Beschaffenheit meines Wesens ist der Neid. Früher habe ich ihn nur immanent, direkt und konkret gekannt – es war ein bestimmter Neid, wegen einer Frau, einer Fähigkeit, wegen Lebensumständen.
Durch mein Altern, vielleicht durch den Tribut, den ich dem Moloch mittlerweile in seinen Schlund kippen muss, durch den damit einhergehenden Verlust meiner Freiheit, in der Gestaltung meiner Zeit und dem Verlust der theoretischen Möglichkeit, alles zu werden, ist auch mein Neid thereotischer geworden: Transzendenter, allumfassender und vor allem brutaler, gewalttätiger. Ich neide nicht nur anderen das Glück, mit dem sie ihre Entscheidungen getroffen zu haben scheinen, sondern auch die Illusion gleich mit, dass dem tatsächlich so sei.
Aber der Neid überkommt mich besonders daher, dass mir, wie in Phantomschmerzen, ständig bewusst ist, was ich nicht habe, dadurch, dass ich mich dazu entschieden habe, es nicht zu haben, in dem ich etwas anderes wollte.
Dieses Gefühl verstopft mir den Rachen derart, dass es oft in der völligsten Perspektivlosigkeit endet, auch mit dem Gefühl der Mittelmäßigkeit, die sich herzhaft aus dem Verlust der theoretischen Allmöglichkeit speist – Mittelmäßigkeit der Erfahrungswelten, Mittelmäßigkeit des empfundenen Glücks, des Behagens, das ich mir ausgesucht habe. Mittelmäßigkeit der theatralischen Sendung. Ich weiß, anders als der Mann in Nietzsches Gleichnis, dass ich an dieser Schlange nicht ersticken werde. Aber ich würde sie gerne ganz hinunterschlucken.